laut.de-Kritik
Ex-QOTSA-Basser Nick Oliveri lädt zum Punkrock-Einlauf.
Review von Michael SchuhEines vorweg: Es ist nicht leicht, Nick Oliveri zu sein. Immer noch nicht. Zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, seit Josh Homme den durchaus folgenschweren Entschluss fasste, seine Band Queens Of The Stone Age um den unberechenbaren Freund der Nacktakrobatik und des Marschierpulver-Konsums zu erleichtern und sich einen neuen Bass-Gefährten zu suchen. Folgenschwer vor allem deshalb, da sich ein stiernackiger Wüstling wie Oliveri natürlich nicht so leicht entblößen lässt, wie es seine luftigen Live-Auftritte vielleicht suggerierten.
In regelmäßigen Abständen brachte sich der Geschasste hernach immer wieder ins Gespräch, meist durch frusterfüllte Interviews, einmal aber auch mit einer unmöglichen Prügeleinlage, die ausgerechnet einen örtlichen Soundmann aus dem schwäbischen Trossingen ins Zentrum des Geschehens hievte (laut.de berichtete ängstlich), was Oliveris Mitstreiter Dave Catching (Gitarre) und Molly McGuire (Bass) schließlich dazu veranlasste, ihm ebenfalls die Gefolgschaft aufzukündigen.
Mit "Dead Planet: Sonic Slow Motion Trails" erscheint nach der nur auf Konzerten vertriebenen EP "III" und dem eher schwierig zu beziehenden Album "Demolition Day" (beide 2004) nun ein Werk, das neue und alte Sachen des Meisters auf einer Langrille zusammen bringt. Aufgenommen zum Großteil in Dave Grohls Studio in L.A. (allerdings ohne Grohl), dürften die 13 Songs bei denjenigen keine Wünsche offen lassen, die sich noch freudig erinnern, wofür der Bart-Tornado früher bei den Queens zuständig war: für grundsolide Punk-Kracher, die nicht immer eine Melodie und noch seltener stimmliches Volumen als essentielle Voraussetzung fürs Rocken erachten.
Ab sofort erscheinen zudem alle Oliveri-Tonträger unter dem ewigen Titel Nick Oliveri And The Mondo Generator, und zwar laut Bandchef aus dem einfachen Grund, dass er es leid sei, bei Live-Gigs bis an sein Lebensende "feat. Ex-QOTSA-Member"-Aufkleber auf den Plakaten zu lesen. An den Sound seiner allseits geliebten Ex-Band erinnert allerdings ohnehin nicht mehr allzu viel.
Sicher zeigen die bereits bekannten Songs "All The Way Down", "So High" oder das rüde Stoner-Riffgewalten herauf beschwörende "Lie Detector" klar und deutlich auf, dass der Mann sein Songwriting-Handwerk unter der glühenden Sonne der Palm Desert gelernt hat. Gleichzeitig hält es Oliveri selbst in diesen melodiefreudigen Nummern nicht für nötig, seine ungestümen Brüllattacken mal stecken zu lassen, was live beeindruckend, auf Platte eher enervierende Wirkung entfaltet.
Was nicht heißen soll, dass sich gerade die genannten Songs, der fulminante Opener "Like A Bomb" (siehe Titel) oder das Ramones'sche "Mental Hell" nicht hervorragend zum Mattekreisen eignen. Oliveri ist nämlich neben seinen unangefochtenen Bühnenqualitäten auch ein ganz passabler Songwriter, dessen einziges Pech darin besteht, neben einem Josh Homme zu Ruhm gekommen sein. Auf der sehr wahrscheinlich autobiographischen Single "I Never Sleep" lässt er seiner Vorliebe für melodiösen Speed Punkrock vollen Lauf.
So regiert auf "Dead Planet: Sonic Slow Motion Trails" vor allem die Power der Dwarves, bei denen Oliveri nach wie vor auch in Lohn und Brot steht. Mit seiner eigenen Band sieht es da schon schwieriger aus. Im Booklet erfahren wir, dass Catching, McGuire wie auch Ex-Drummer Hernandez nur noch für den alten Song "All The Way Down" Credits einheimsen, dafür scheint der von den Brit-Bluesern Winnebago Deal rekrutierte Marc Diamond Oliveris neuer Spielkamerad an der Gitarre zu sein. Ebenfalls an der Gitarre sowie am Piano steht nun ein gewisser Mathias Schneeberger, den Oliveri allerdings kaum aus Trossingen mit nach Hause geschleppt hat, da der schon mal bei einer Desert Session vorbei schaute.
Zum Abschied drischt Oliveri mit "Sam Hall" dann noch eine traditionelle Nummer durch den Punkwolf, die mit der getragenen Johnny Cash-Version nurmehr den Titel gemein hat. Keine Frage, wenn Josh Homme in diesem Rock'n'Roll-Zweiergespann der David Bowie war, ist Nick Oliveri der Iggy Pop. Die beiden Berliner WG-Genossen aus den 70er Jahren hielten es übrigens nur zwei Alben lang miteinander aus.
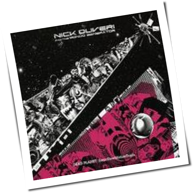



Noch keine Kommentare