laut.de-Kritik
Melancholische Perlen aus Indiepop und Jewish Folk.
Review von Ulf Kubanke"Where is the river that runs though the heart of all this sand?" Unablässig flickert die Gitarre wie die von Steve Levis mit sanftem Timbre beschworenen Sandkörner. Seine Stimme birgt die Erleichterung eines Menschen, der nach langer Sehnsucht und entbehrungsreicher Distanz endlich dort ankommt, wo er hingehört. "I am no longer alone." Ebenso zart wie durchdringend bestätigt die Klarinette das besungene Gefühl, bevor "Arrival" so richtig loslegt.
Manchmal kommen sie wieder. Fast eine Dekade dauerte es, bis Oi Va Voi mit neuer Studioplatte aus der Versenkung auftauchen. "Memory Drop" ist genau jenes Album, das man sich von ihnen schon immer wünschte. Zehn melancholische Perlen aus Indiepop und Jewish Folk ergeben eine herausragend intensive Melange.
Sechs Jahre nach dem soliden "Travelling The Face Of The Globe" nahmen sich die beiden Vordenker Steve Levi und Josh Breslaw ausgiebig Zeit für eine überfällige Verfeinerung ihres Songwriter-Talents. Dabei schrieb Levi sämtliche Texte, während Breslaw sich besonders der Produktion widmete. Im Verlauf stieß die Tel Aviver Alternative-Musikerin Zohara Niddam hinzu, die sich, unter ihrem Vornamen auftretend, in ihrer Heimat bereits als respektierte Künstlerin etablierte.
Zohara als Glücksfall zu bezeichnen, käme einer Untertreibung gleich. Sowohl gesanglich als auch kompositorisch addiert sie zu Oi Va Voi exakt jenes Quentchen überwältigender Ausstrahlung, die den eigenen Liedern in der Vergangenheit mitunter fehlte. Seien es die Melodien, Arrangements oder das notwendige Aus-Einem-Guss-Gefühl: Gemeinsam mit Zohara ergibt sich eine Komplettheit, deren charismatische Substanz das Prädikat Weltklasse verdient.
Trotz Umbesetzung und eines Umfangs von neun Mitgliedern klingt das in London beheimatete Kollektiv endlich nach echter Band statt nach Projekt. Doch "Memory Drop" geht als Album sogar noch einen Schritt weiter. Endlich atomisieren sie vollends den schon immer unsäglich unpassenden Weltmusik-Stempel. Mit der oftmaligen Beliebigkeit jenes Samelbegriffs, der längst eine eher ziellose Multikulti-Schublade mit stereotypem Dritte Welt-Duft verkörpert, haben die Stücke nichts gemein.
Stattdessen lautet das Motto: Indiepop vermählt sich mit tiefschürfendem Singer/Songwriter-Spirit und ergänzt wohldosierte Elemente jüdischen Folks. Fast alle Tracks offenbaren eine melancholische Note, deren Grundton die ausnahmslos sensiblen, dezent politischen Texte unterstreicht.
Jede einzelne Nummer taugt zum Aushängeschild. Wenn Zohara in "Vanished World" oder "Unknown Adress" die Lavalampe gehobenen Weltschmerzes anknipst, wärmt sich des Hörers Herz augenblicklich. Treten in "Big Brother" oder "Searchlight" noch elegante Indierock-Faktoren hinzu, bricht der dynamische Kontrast die Platte gekonnt aus dem Rahmen dominanter Niedergeschlagenheit. In "Through The Maze" prallen beide Stilmittel effektiv aufeinander.
Erwartungsgemäß hat Levi es nicht leicht, ihrer Ausstrahlung nah zu kommen. Doch es gelingt ihm bravourös. "Empty Boxes" etwa hypnotisiert das Publikum durch emotionale Melodik der Extraklasse. Seine mitunter nahezu sphärische Entrücktheit im Gesang funktioniert ähnlich stimmig wie seinerzeit bei Paul Roland, an den Levis Organ gelegentlich erinnert ("Opium").
Im Finale "Shelter" treibt Levi diese Methode mit fast sakral hallender Geste auf die Spitze wie weiland Dead Can Dance in ihren besten Zeiten, während der instrumentale Teppich eine Art Shtetl-Psychedelik hinzu gibt. Diese Platte hat das Zeug zum Klassiker.

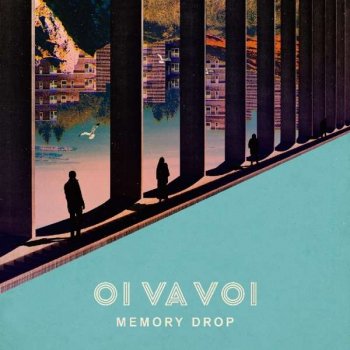












Noch keine Kommentare