laut.de-Kritik
Eine Lehrstunde für Pseudo-Indies von Oomph! bis Unheilig.
Review von Ulf KubankeOhne jede Aufschneiderei muss man Phillip Boa als europäisches Indie-Helden-Urgestein bezeichnen. Egal ob Engländer oder Franzosen, ob Tony Visconti (Bowie), Dave Lombardo (Slayer) oder Chuck Schuldiner (Death): Sie alle kamen, wenn er rief. Boa war vor rund 20 Jahren der einzige deutsche Alternative-King, bis zum Rand gefüllt mit Credibility wie hierzulande höchstens noch Kraftwerk oder die Neubauten.
Gleichwohl ist er den Untiefen gräulichen Vergessens anheim gefallen. Die jungen Indie-Hörer kennen ihn nicht mehr. Diese Kids jedoch haben ihre eigene Revolution gefressen, nicht umgekehrt. Die wichtigen ersten beiden LPs sind vergriffen. Gähnende Boa-Leere auf den Dancefloors. Ein furchtbar unverdienter Zustand.
Doch nun ist Schluss mit solch trüben Umständen. Die 1993er "Boaphenia"-Platte setzt zusammen mit dem avantgardistischen Vorgängeralbum "Helios" die feine Rerelease-Reihe fort, gespickt mit zahlreichen teils hochinteressanten Bonustracks. Doch warum beginnt man ausgerechnet mit diesem Album? Ganz einfach: "Boaphenia" hat seinerzeit nicht nur großen internatonalen Erfolg eingefahren. Die Scheibe gilt zu Recht als ultimative Trickkiste des umtriebigen Dortmunders. Modern im Sound ohne jede Form spekulativer Anbiederung. Gleichzeitig immer ein wenig derb und hemdsärmelig.
Eigentlich hätte Boa sich mit diesem Album zwischen alle Stühle setzen müssen. Keine Noise-Attacken wie bei "Aristocracy". Keine verzierenden Zwiebelhautschichten wie im künstlerischen "Copperfield". Und auch kein farbenfroh überdekorierter Weihnachtsbaum wie das umjubelte "Hair". Wiederholungen waren ohnehin nie seine Sache. Stattdessen zeigt der kreative Querulant allen Musikpolizisten die lange Nase und geht einen deutlichen Schritt Richtung Clubtauglichkeit und lässigen Dance-Appeal.
Solch ein oft unausgegorener Schritt bescherte anderen Rocker-Kollegen nicht selten einen üblen Karriereknick und den Spott des Publikums frei Haus. Chris Cornell kann mit seinem Dance Album-Experiment ein düsteres Liedchen davon pfeifen, wie schnell man zur Lachnummer eines Publikums verkommt. Boa passierte das nicht. Noch heute gilt das Album als Lehrstück perfekten Indiepops. Warum nur?
Die genutzten Effekte klingen auch nach knapp 20 Jahren noch wie aus einem Guss. Altmodische Patina? Vergesst es! Boas Zauberformel ist dabei alles andere als schwarze Magie. Sein grob kehlig-brüchiger Ungesang schart alle Ecken und Kanten um sich. Die fiesen, sehr variablen Gitarren, harten Drums und schrägen Effekte. Das leidenschaftliche "Fiesta" mit seiner dramatischen Melodieführung mag man hier als Paradebeispiel heranziehen.
Auf der anderen Seite steht die damalige Gattin Pia Lund mit gewohnt aufreizendem Lolita-Gesang. Immer bereit, den harmonisierenden Honig in jene Spalten und Zwischenräume zu werfen, die ihr Ehemann mit seinem ungehobelten Berserkertum aufschlägt. "Get Terminated" ist solch ein Stück, das allein durch Pias Balsam in "Where's some room for a poetic mouth / Where has all the love gone?" vom Trecker mühelos zum Ferrari mutiert.
Doch auch die Grobheit des Zeremonienmeisters und seiner Arrangements darf nicht als tumbe Grobschlächtigkeit missdeutet werden. Das nur scheinbar schludrige Element dieser CD ist in Wahrheit minutiös konzipiert und – bei aller Schieflage – essentielles Puzzleteil, das den oft lieblichen Refrains fettsträhniges Straßenkötertum entgegensetzt. Das Formatradio bleibt bewusst und smart in weiter Ferne.
Dennoch wäre Ernst Ulrich Figgen nicht Phillip Boa, wenn er nicht - fast schon beiläufig - einen fetten Chartbreaker im Programm hätte. "Love On Sale" ist wie guter Wein. Schon damals war der Ohrenschmeichler - wie vor ihm "And Then She Kissed Her" und "Container Love" - ein geschmeidiger Botschafter zwischen den Indietectives und einer eher dem Mainsreampop zugewandten Hörerschaft. Heutzutage möchte man solch einen fetten Abräumer nur all zu gern den ganzen krankhaft einspurigen Powerchord-Pseudo-Indies von Oomph! bis Unheilig als Pflichtlektüre unter das verkitschte Kopfkissen legen.
"... from the beauty / for the damned / days of shame", my dear! Ein perfekter Popsong für die Ewigkeit. Ohnehin ist die Dichte an eingängigen wie rüpelhaften Edelsteinen bemerkenswert. Ein wuchtiges Kleinod wie "Euphoria" möchte ich jedem Boa-Novizen ans Herz legen. Der leicht Sisters-artige Flow und das sich hermetisch verriegelnde Schlüssel/Schloss-Prinzip zwischen Phillip und Pia ließ nicht einmal Amputierte und Versehrte dröge an der Tanzfläche vegetieren. Zappelzwang deluxe!
Die sieben Extratracks sollten überdies jeden altgedienten Freund des Voodooclub-Präsidenten hinter dem sprichwörtlichen Ofen hervorlocken. Zwar halten die ehemaligen Outtakes nicht durchgehend den Qualitätsstandard des Mutteralbums. Doch Stücke wie das entspannt mediterrane "Scandal" oder das zwischen Ironie und Schweiß pendelnde "Black Sex Guru" machen diese Wiederveröffentlichung letzten Endes unverzichtbar. Bitte noch die ersten zwei Alben in dieser liebevoll gestaltenen Variante nachschieben.






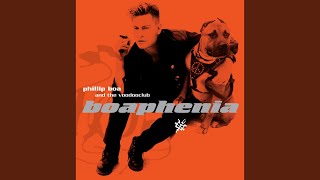



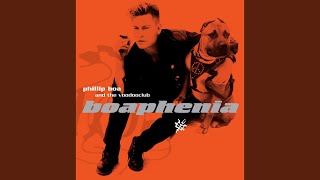


Noch keine Kommentare