laut.de-Kritik
Was kann dieser junge Mann eigentlich nicht?
Review von Thomas HaasDas bisherige Schaffen eines gerade einmal 21-Jährigen lässt sich in der Regel in wenigen Sätzen abhandeln. Bei Steve Lacy, diesem multiinstrumental begabten Kid aus Compton, Los Angeles, gestaltet sich diese Aufgabe ungleich schwerer. Auf seiner Habenseite stehen neben einer Grammy-Nominierung im Schulalter mit seiner Band The Internet bereits Kollaborationen mit Kendrick Lamar, Blood Orange und jüngst Vampire Weekend. GoldLink ließ sich mit den Worten: "Steve Lacy ist ein Genre für sich" zitieren. Warum diese musikalisch durchaus versierten Künstler auf die Dienste eines Teenagers schwören? Diese Frage beantwortet "Apollo XXI" mit Nachdruck. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass sich hier gerade etwas Großes in Gang setzt.
Was Steve Lacy vor ein paar Jahren mit dem einem iPod Touch und der Musik-App GarageBand im eigenen Kinderzimmer anstieß, hat längst ungeahnte Auswüchse angenommen. Schon im Sommer 2017 gelang ihm mit seinen LoFi-Produktionen auf nur 13 Minuten "Steve Lacy's Demo" ein Achtungserfolg, in etwa zeitgleich stieg er bei The Internet vom "einfachen" Gitarristen zum zweiten Frontmann auf. Zurückzuführen ist das in erster Linie auf seine leichtfüßigen Produktionen und Melodien, die er auch heute noch als Skizzen auf dem Handy einspielt. Vielleicht klingen sie auch deshalb genau so, wie sie ein 16-köpfiges Produzenten-Team im High-End-Studio niemals nachahmen könnte.
"Apollo XXI" gilt nun als erstes wirkliches Statement, als die Verortung des künstlerischen Profils Lacys. Es spiegelt die Seelenwelt des 21-Jährigen (und wohl auch die vieler seiner Altersgenossen) authentisch wider. Die Zerrissenheit zwischen Selbstüberhöhung und Unsicherheit ist in fast allen Songs spürbar. Nach dem zuckersüßen Intro "Only If" bekennt sich Lacy zu seinen pragmatischen Absichten: "This is about me, what I am. I didn't wanna make it a big deal, but I did wanna make a song, I'll admit." Und weiter: "I don't know if you can still relate, and that's what I'm afraid of. I just wanna relate to everyone."
Der nachfolgende Song "Like Me", das inhaltlich zentrale Stück von "Apollo XXI", gibt diesem Eingangsmotiv noch eine weitaus gewichtigere Bedeutung. In unnachahmlich müheloser Steve Lacy-Manier bringt der Kalifornier seine Bisexualität ins Spiel und stellt diejenigen Fragen, die ihn vor dem Schlafengehen umtreiben: "How many out there just like me? / How many work on self-acceptance like me? / How many face a situation like me? / […] / How many others not gon' tell their family? / How many scared to lose their friends like me?" Nichts weiter Ungewöhnliches für einen Menschen Anfang Zwanzig, möchte man meinen.
Blickt man auf die weiteren Teile der ingesamt zwölf Songs, fällt "Like Me" durchaus eine gewisse Sonderrolle à la: 'Herz ausschütten nur, um danach entschieden auf die Kacke zu hauen' zu. Die nachfolgenden Zwei- oder allenfalls Dreiminüter beschäftigen sich stattdessen vorrangig mit Geschichten über intensive Bekanntschaften und sexuelle Freiheit in sämtlichen Facetten. Was Steve Lacy dabei aus künstlerischer Sicht kredenzt, lässt einen in nicht wenigen Momenten daran zweifeln, was man eigentlich in der eigenen Adoleszenz so zustande gebracht hat.
Zwischen kalifornischem Funk und Soul der klassischen Sorte und modernem R'n'B bedient Lacy sich einer riesigen Bandbreite, an der sich selbst etablierte Künstler locker überheben könnten. "In Lust We Trust" fände in seiner funkigen Reduziertheit auch Platz auf einem Thundercat-Album, "Love 2 Fast" orientiert sich hingegen am melodischen "Currents"-Sound von Tame Impala und endet mit einem irrwitzig selbstverständlichen Gitarrensolo.
Nicht nur die klare musikalische Vision Lacys hält die Songs zusammen, sondern auch ihre Unfertigkeit. Nichts an diesem Album fühlt sich verkopft oder gar konstruiert an, stattdessen wirkt Lacy auf halber Länge in etwa so angestrengt wie nach einem kurzen Einkauf im Supermarkt.
Richtig abgefahren wird es auf "Guide", wo Lacy sich in neue stimmliche Höhen vorwagt, oder auf "Hate CD", das nicht ohne Grund viele Hörer an die Wärme und das Charisma eines frühen Prince erinnert. Wie zum trotz schließt "Apollo XXI" mit einem herrlich ignoranten Rap-Brett: "Apollo double-X-I, fuck a double-X-L / I've been eating my greens, I've been eating my kale / […] / I'm so hot, I'm so hot, you'd think I was from hell", tönt er da etwa und lässt den Hörer verzweifelt rätseln, was dieser junge Mann denn bitteschön nicht kann. Das anschließende Soul-Outro (cc: Kanye's Sunday Service), das bereits auf dem großartigen Solange-Album zu hören war, kommt zu der Frage noch erschwerend dazu.
Im Grunde steht Steve Lacy nichts im Wege, um ein neues Idol seiner Generation zu werden. Weil er sich dieses Umstands offensichtlich bewusst ist (Lacy war außer auf zahlreichen Magazincovern bereits auf einer Modenschau von Louis Vuitton zu sehen und spielte das gesamte Album in Eigenregie ein), geht "Apollo XXI" durchaus als freudestrahlender Auftakt in Richtung von Posterwänden und Insta-Feeds dieser Welt durch.




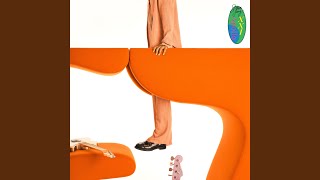






![[FREE] Steve Lacy x Hotel Ugly Type Beat "Impossible"](https://i.ytimg.com/vi/PB-SwSLchmc/mqdefault.jpg)


Noch keine Kommentare