laut.de-Kritik
Tagsüber ist es viel zu hell für diese Platte.
Review von Sebastian FuchsEin Fiebertraum. Das zerfahren nervöse Gleiten zwischen der Ahnung einer Stimme, eines Sounds und treibend schweren Trommeln. Die Band aus der Saddle-Creek-Familie veröffentlicht zum dritten Mal ein Album. Schafft es Andy LeMaster erneut diese schmachtenden, vertrackten Songs zu erzeugen, die sich zwischen elektronischer Frickel-Produktion, dem Gefühl unendlicher Klanglandschaft und unzähligen menschlichen Abgründen bewegen? Ja, er kann, sie können es.
LeMaster, Schlagzeuger Clay Leverett sowie Orenda Fink und Maria Taylor von Azure Ray hinterlassen mit "Dark Light Daybreak" zehn Elegien, die man schlecht tagsüber hören kann - es wäre viel zu hell für diese Platte. Manchmal geht es härter und drängender zu als auf den Vorgängern. Fast so, als wollten Now It's Overhead für einen Moment lang der ihnen eigenen melancholischen Langsamkeit entfliehen.
Zum Beispiel bei "Wails". Hier kommt der Rhythmus ungewohnt hektisch und gebrochen daher und LeMaster bellt die Strophen fast heraus. Das schnellste und treibendste Indiestück, dass der Vierer je gemacht hat. Auch "Type A" überrascht mit seiner Direktheit, dem schnörkellosen Riff und der fehlenden Elektronik. Da gibt es aber auch wieder die Stücke, die die besondere Stimmung der Band aus Athens ausmachen.
Etwa der Opener "Let the Sirens Rest" mit seinem scheppernden Anfang. Die Wärme, die Now It's Overhead stets ausstrahlten, schleicht sich aber sofort wieder ein. Stimme und Drums schnappen sich den Hörer, und wenn der Bass zum ersten Mal die Tonhöhe wechselt, tut sich eine ungeahnte Weite auf. Oder "Estranged", bei dem jedes Wort der Zeile "I feel a change, i feel estrange" dringlich heraus gepresst und erlitten wird - erstmals hört man auch die Mädels von Azure Ray im Hintergrund. Der Refrain wird mit jedem Mal wuchtiger und schält sich immer leuchtender heraus.
Musikalisch dominieren wunderbar ergreifende Moll-Nuancen, die umspielt und minimal verändert werden - eine Konstante der Band, die das Eintauchen in tiefe Traumbilder ermöglicht. Behäbige Trommeln und ein hymnischer, hoch gesungener Refrain prägen "Believe What They Decide".
"Night Vision" wird dagegen von einem Glockenspiel zusammengehalten. LeMasters Stimme klingt fragil und manchmal flattert sie ein wenig, als wäre das Gesungene für den Sänger selbst zu emotional und schwer erträglich, bis er im spärlichen Refrain von einer zweiten Stimme unterstützt wird. Diese wenigen Variationen und das Auseinanderziehen der Worte verleihen seinem Organ eine atmosphärische Dichte.
Das Titelstück drängt dann zum Aufbruch, es ist ein neuer Tagesanbruch, der aber in ein gedämpftes, dunkles Licht getaucht wird. Ein Höhepunkt auch "Meaning To Say", eingeleitet von schneller akustischer Gitarre und pumpenden Synthies. Aus dem einfachen Arrangement wächst ein großes, sinfonisches Lied heran, das Fieber steigt an. Bei "Let Up" ist die Stimme von LeMaster wieder dieses kleine zerbrechliche Etwas, das man von Conor Oberst kennt, auch die Gitarre und das reduzierte Sound-Gewand erinnern an manches Bright Eyes-Stück.
Der Song geht dahin, wo die Nerven dünn sind. LeMaster steigert sich, unterstützt von einer zweiten Stimme, in die depressiv dramatische Schlusssequenz hinein: "I won't die, i won't die". In bestimmten Nächten schnürt dieser Song die Kehle zu. "Nothing in Our Way" gibt sich - wie das gesamte Album - etwas weniger elektrisch. Ein befreiendes Lied zum Schluss, das den Hörer allein mit aufgewühlten Gefühlen zurück lässt.



![Now It's Overhead - Walls [Official Music Video]](https://i.ytimg.com/vi/akoBAcD664M/mqdefault.jpg)



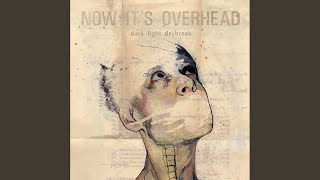






Noch keine Kommentare