laut.de-Kritik
Die Grunge-Legenden klingen wie Epigonen ihrer eigenen Epigonen.
Review von Sven KabelitzNetterweise hat die Sache mit dem Älterwerden die Gewohnheit, nicht über Nacht zuzuschlagen. Der körperliche Zerfall und die persönliche Entwicklung der Menschen erfolgt nicht von jetzt auf gleich, sondern schleicht sich ein. Hätte man meinem 19-jährigen Ich 1994 zum Beispiel die Pearl Jam-Version des Jahres 2024 gezeigt, ich hätte mir abrupt die Haare abgeschnitten, mein Holzfällerhemd verbrannt und möglicherweise sogar geduscht.
Es sind Kleinigkeiten, die sich mit der Zeit veränderten, aber letztendlich zu einer Diskrepanz im Gesamtbild führen. Ganz oben auf der Liste steht die Zusammenarbeit mit Ticketmaster, die bei der "Dark Matter"-Tour für obszöne Ticket-Preise sorgte. Ausgerechnet von der Band, die vor dreißig Jahren gegen das Unternehmen in den Ring trat. Nur weil man sich mittlerweile an etwas gewöhnt hat, bedeutet es nicht, dass es richtig ist und man es hinnehmen muss.
Dazu kommt Eddie Vedder, der mal wieder im besten PR-Sprech wie zu jedem neuen Release ein "Ohne zu übertreiben, ich denke, das ist unsere beste Arbeit" von sich gibt. Wohl wissentlich, dass da draußen einige Fans dank "Ten", "Vs." und anderen Großtaten der Vergangenheit am Ende möglicherweise anders denken könnten. Aber Hauptsache, die Erwartungen und so den Absatz gesteigert. Hinzu kommt auch ein Cover-Artwork, als hätten Tool einen schlechten Tag gehabt, und schließlich die Wahl von Andrew Watt (Justin Bieber, Iggy Pop, Post Malone, Miley Cyrus) als Produzent, der mit seinem Standardsoundbrei bereits Vedders "Earthling" und "Hackney Diamonds" verhunzte. Letztendlich für die Rolling Stones des Grunge nur eine logische Wahl.
All dies dient nur als Rahmenhandlung, letztlich zählt bei der Bewertung eines neuen Longplayers alleine die Musik. Nach dem eher durchwachsenen "Gigaton" war eine Frischzellenkur durchaus nötig. Josh Evans ließ Pearl Jam ungewohnt hüftsteif klingen, und schon wieder zu Brendan O'Brien zu greifen, wäre auch irgendwie öde gewesen. Watts erstickt "Dark Matter" jedoch. Zeigen die Songs selbst den kleinsten Hauch von Dynamik, drückt er ihnen so lange ein Kissen ins Gesicht, bis ihnen die Luft weg bleibt. Er lässt die Band teilweise wie die Epigonen ihrer eigenen Epigonen klingen.
Abgesehen vom aufgeblasenen Sound hat sich gar nicht so viel verändert. Der in gerade einmal drei Wochen in den Shangri-La-Studios geschriebene und aufgenommene Longplayer gibt sich zu Beginn mit "Scared Of Fear", "React, Respond" und dem Titelsong temperamentvoll wie lange nicht mehr. Gerade in der ersten Hälfte zeigen sich Pearl Jam spielfreudig, strotzen zeitweise vor Energie und führen auf eine falsche Fährte. Legt man das mittlerweile zwölfte Album aber kurz zur Seite, zeigt sich schnell, wie wenig von den Songs hängen bleibt. Letztendlich bedienen sie beim Songwriting ihre von sich definierten Standards, spielen diese nur etwas kraftvoller. Die Stücke verfügen zwar über ein hohes Niveau, doch fehlt ihnen so ein langfristiger Wiedererkennungswert. Was wiederum nichts an der Klasse des Gitarrensolos in "React, Respond" ändert.
Schnell verfällt "Dark Matter" wieder in den Midtempo-Rock, den man mittlerweile mit Pearl Jam verbindet. Über die Jahre entwickelte sich dabei ein Hang zum Schwülstigen. Als deutliches Highlight stellt sich hier schnell "Wreckage" heraus, auch wenn es zeigt, wie sehr Pearl Jam ihre Tracks mittlerweile nach Zahlen malen. Dennoch dürfte sich der Titel wohl langfristig in die Live-Setlists mogeln. Eher unangenehm fällt hingegen der triviale Schunkler "Something Special" aus.
"Running" möchte die Wut früher Ausbrüche wie etwa in "Lukin" ("No Code") einfangen, bleibt aber viel zu geordnet. "Waiting For Stevie" verfügt über eine gehörige Portion 1992-Seattle-Vibe. Dies zeigt sich besonders, wenn für einen kurzen Moment Gitarre und Bass für sich stehen. Kurz darauf dümpelt das Schlagzeug hinein. Der Sound verkommt leider zu einem einzigen Klumpatsch, in dem sich das Gitarrensolo komplett verirrt. Hervor sticht der gelungene Abschluss "Setting Sun" mit deutlichen Bruce Springsteen-Parallelen ("My Hometown"). Ein versöhnlicher Abschluss für ein launenhaftes Werk.
Wie jedes Album ab dem 2006 veröffentlichten "Pearl Jam" spielt "Dark Matter" einem im ersten Moment vor, ein wirklich gutes Pearl Jam-Album zu sein. Tritt man einen Schritt zurück, stellt sich jedoch schnell fest, dass man auch diese Lieder wieder wahllos über die letzten fünf Werke verteilen könnte, es würde keinen Unterschied machen, wo sie landen. Viele verfügen über eine einwandfreie Qualität, doch der bleibende Funke, die Magie ging ihnen schon lange flöten.
So nehmen Pearl Jam letztlich die Position ein, die in ihrer Blütezeit Teenager Acts aus den 1960ern und 1970ern belegten. Jene Jugendliche von einst, auf die damals geschimpft und deren Musik nicht ernst genommen wurde, dürfen nun endlich auch Sätze wie "Das war noch Musik!" absondern. Die Band verkörpert unterdessen in den Augen vieler junger Menschen von heute genau die Art von Langweiler:innen, von denen sie sich distanzieren. Dabei sind sie sich noch nicht bewusst, dass ihnen und ihrer Musik, wenn sie nicht aufpassen, in dreißig Jahren genau dasselbe Schicksal blüht. Das Generations-Karussell dreht sich unbeirrt weiter. Pearl Jam liefern mit "Dark Matter" nur ein weiteres Zahnrad dafür. Nicht mehr, nicht weniger.
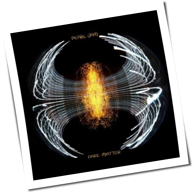












18 Kommentare mit 13 Antworten
"Er lässt die Band teilweise wie die Epigonen ihrer eigenen Epigonen klingen." Ja schön, nun muss ich nach langer Zeit wieder an The Calling denken.
Aaaaaaadrienne...I thought I loved you
https://www.youtube.com/watch?v=OHx6CRR3Ai4
Nach "Binaural" existiert diese Band für mich nicht mehr.
Find ja, dass "Binaural" die erste Scheibe war, bei der nur mehr zwei oder drei Nummern richtig gut warenn. Bis "Yield" war die Dichte an Supernummern außergewöhnlich. "Backspacer" war ein positiver Ausreißer imho.
ganz schön mediocre
Immer noch eine gute Band. Die Rufe nach „auflösen“ können doch nicht ernst gemeint sein. Wenn man den Maßstab anlegt bleibt bei dem aktuellen Schrott nicht mehr viel übrig. Und ein PJ Konzert wird auch in 5 Jahren noch viel emotionaler sein als ein Avatar Konzert von anderen Bands. Vielleicht ist das allerdings der Zahn der Zeit. Definitiv ohne mich.
Auch nach drei Durchgängen bleibt es beim ersten Eindruck: belanglos !
Mir hat das Album doch recht gut gefallen, auch wenn wirklich viele der Stücke nach einer Routine-Arbeit der Band klingen.
Neben dem Titeltrack halte ich besonders das experimentelle Upper Hand aber auch die melodisch, gitarrenlastigen Stücke wie Scared Of Fear, Waiting For Stevie (trotz des Epilogs) & React, Respond für die besten Minuten des Langspielers und würde Diese zum Anhören weiter empfehlen.
Das softe Something Special ist wirklich etwas speziell und hätte vielleicht besser zu einer Sängerin wie Amy MacDonald oder Norah Jones gepasst. Trotzdem gefällt mir der melodische Track ebenfalls, anders herum als beim Autor des Artikels, da ich viel eher das blasse Wreckless für den schwächsten Track auf dem Album halte.
Setting Sun hätte zum Ende hin etwas kürzer treten dürfen und Won't Tell kann sich nicht so ganz auf dem Album bemerkbar machen, trotzdem zwei schöne Stücke, die mit der Zeit wachsen. Anders als Got To Give, was mit dem plumpen Refrain etwas zu aufdringlich wirkt.
Running klingt für mich wie die Zwillingsschwester von PJs älteren Song Supersonic und überhaupt scheinen sich hier und da kurze Melodie-Fetzen von älteren Songs der Band wie Super Blood Wolf Moon, In Hiding, Sirens und Marker In The Sand eingestreut zu haben. Zumindest in meinen Ohren.
Nichtsdestotrotz 3 von 5 Sterne ist eine absolut faire Bewertung für ein recht zahmes Album mit wenig Herausforderungen für den Hörer, dafür aber viel gelungene Routine und mit Sicherheit ein Wohlklang für die meisten Fans der Band.