laut.de-Kritik
Überirdisch - und über die Maßen irdisch.
Review von Dani FrommVom Tanya Tagaqs zarten Äußeren sollte man sich bloß nicht täuschen lassen. In der Kehle dieser Frau wohnen Urgewalten. Nein, es klingt beileibe nicht alles schön, das die kanadische Sängerin ihrer Hörerschaft auf "Animism" zumutet. Nach anheimelnden Wohlklang steht ihr aber ganz offensichtlich nicht der Sinn, schon eher nach intensiven, körperlich spürbaren Grenzerfahrungen. Als nichts anderes nämlich entpuppen sich die Tracks ihres Albums - das vierte, mittlerweile, das Monate nach seiner Veröffentlichung in Kanada nun auch hierzulande offiziell erscheint.
Kehlkopfgesang besitzt bei den Inuit eine lange Tradition. Tanya Tagaq hat sich die uralte Kulturtechnik zu Eigen gemacht und stellt sie zusammen mit ihren Mitstreitern in einen neuen Kontext. Die Musik, die daraus erwächst, pulverisiert Horizonte in lautlosen Explosionen. "Animism" entzieht sich so vollständig jeder Kategorisierung, dass die Platte außerhalb von Zeit und Raum zu stehen scheint, überirdisch. Zugleich wirken die Tracks über-irdisch, über alle Maßen greifbar, pulsieren sie doch im Rhythmus des Lebens, spiegeln die unaufhaltsamen Kreisläufe: Ebbe und Flut. Ekstase, Klimax und Entspannung. Werden und Vergehen. Geburt und Tod.
Mit archaischer Wucht brechen Tanya Tagaqs Stücke über ihr Publikum herein, mit ganz großer Geste, ohne dabei abgegriffene Pathos-Schablonen zu brauchen. "Caribou" hebt mit dramatischen Streichern an. Die Melodien zerfasern, ehe sich die Stränge wieder finden, einander an-grooven und irgendwann in einem gemeinsamen Rhythmus schwingen. Darüber erhebt sich Taqags Stimme, gewöhnungsbedürftig, spröde und ziemlich verrückt, zugleich aber auch unglaublich fesselnd.
Kehllaute und Gesang, von Gebrüll über Schreie und Grunzen über irrlichterndes Kichern bis hin zum Keuchen und Flüstern bis zum wispernden Seufzer: Tanya Tagaq zieht alle Register, darunter solche, von denen man bisher höchstens ahnte, dass sie sich in einer menschlichen Kehle finden lassen. Wiederholungen, sich überlagernde Loops und Echos ziehen - ganz ähnlich wie Steve Reichs Minimal-Experimente, die unter anderem Brian Eno inspirierten - erst in ihren Bann und dann in einen Strudel. Summen, Brummen, Atmen, Wimmern und Singen gehen nahtlos ineinander über. Grenzen, so es sie je gegeben hat, zerfließen.
Mindestens ebenso virtuos spielt das musikalische Beiwerk mit Dynamik. "Uja" etwa verbindet tickenden Rhythmus und schnarrende Klänge mit - im Gegensatz dazu - voluminösen Trommeln. In "Umingmak" sticheln spitz quietschende Geigensaiten aufs Nervenkostüm ein, bis eine breit grummelnde Bassfront wie eine Schlammlawine über den Track hinwegrollt und alles mit sich reißt. Einzig die Stimme geht in diesem Malstrom nicht unter, behauptet sich gegen die Elemente.
Die Bläser, die "Rabbit" flankieren, würden auch im nächsten "Batman"-Soundtrack keine schmächtige Figur abgeben. Die zarten Laute, die Tanya Tagaq dieser Macht entgegen stellt, fressen sich ohne Umweg über den Verstand direkt ins Unterbewusstsein, legen dort knisternd Feuer und schwelen noch lange, lange nach, auch wenn die Nummer schon längst verhallt ist.
"Damp Animal Spirits" tanzt einen geradezu klassischen Balztanz, steigert sich von der langsamen Annäherung in die Erregung hinein, ehe der Track nach dem Höhepunkt unmittelbar in sich zusammenfällt. Im abschließenden "Fracking" fragt man sich zwischendurch besorgt, ob die Sängerin ihre Anstrengungen überhaupt überleben kann. Von einem Moment auf den anderen löst sich dann aber die Spannung. Alles ist gut - oder doch zumindest vorbei.









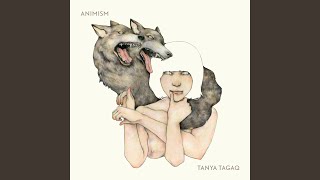




Noch keine Kommentare