laut.de-Kritik
Mehr als nur "Exile In Guyville".
Review von Giuliano BenassiEs fällt schwer, einen Artikel über Liz Phair zu beginnen, ohne gleich im ersten Absatz jenes Album zu nennen, das sie 1993 bekannt machte: "Exile In Guyville". Damit hat sie selbst kein Problem: 2008 veröffentlichte sie eine Deluxe-Ausgabe mit eigens gedrehter Dokumentation, 2018 dann einen Rückblick mit viel zusätzlichem Demomaterial, mit dem sie ausgiebig auf Tour ging. Alles andere, darunter vier weitere Studioalben, ist mehr oder weniger in Vergessenheit geraten.
Elf Jahre nach "Funstyle" kehrt sie in einer gewissen Hinsicht zurück zu den Wurzeln. Auf jeden Fall zurück zu Brad Wood, der ihr Debüt (und eineinhalb der folgenden zwei Platten) produziert hatte. Nicht mehr in Chicago, sondern in Los Angeles, wo sich beide (unabhängig voneinander) niedergelassen haben. Dort ist das Thema des mittlerweile historischen Erstlingswerk aktueller denn je, dazu noch politisch stark aufgeladen. "Every time I see your face, I get all wet between my legs ... I want to fuck you like a dog ... I'll fuck you 'til your dick is blue", sang Phair mit unschuldiger Stimme in "Flower". Emanzipation? Ja. Aber auch eine groteske Verzerrung jenes Gockelgehabes, das viele frühere Rockbands auszeichnete.
In diesem Sinne also eine Inspiration für jüngere Generationen von Frauen, die für Gleichberechtigung kämpfen. Auch auf "Soberish" dichtet Phair durchaus anzüglich, etwa in "Bad Kitty" ("My pussy is a big dumb cat / It lies around lazy and fat / But when it gets a taste for a man / It goes out huntin' for him anyway it can"), doch beobachtet sie auch gerne. Im besten Stück des Albums "Hey Lou" stellt sich eine Konversation zwischen Laurie Anderson und Lou Reed vor. "No-one knows what to think / When you're acting like an asshole / Spilling all the drinks / Talking shit about Warhol", singt Phair unter anderem, doch klingt es eher wie ein Augenzwinkern als eine Anschuldigung. Und nach jenem 1990er Indie-Pop, mit dem sie bekannt wurde.
"Ich bin jetzt eine viel bessere Sängerin, Produzentin und Gitarristin als in den 90ern", erklärt sie in einem Interview mit der Zeitschrift Vanity Fair, "meine Melodien und Akkordfolgen sind viel komplexer und interessanter". Da hat sie sicherlich recht, doch ist sie mittlerweile auch fast 30 Jahre älter. "Es gibt eine reine, unverdorbene, unbefangene Schönheit in den frühen Alben, die ich nicht wieder einfangen kann. Ich kann nicht vergessen, was ich weiß."
Viel erlebt, aber nichts wirklich bereut, so der Eindruck. "There's so many ways to fuck up a life / I try to be original / Done plenty more wrong than I ever did right / Still I'm not a criminal", singt sie in "Good Side", ohne zerknirscht zu klingen. In der Tat läuft es für sie nach wie vor gut, mit gelegentlichen Rückschlägen. So war ihr großes Projekt in den 2010er eine Art Fortsetzung von "Exile In Guyville", das ja seinerseits so etwas wie eine Antwort auf "Exile On Main Street" der Rolling Stones war. Diesmal hatte sie sich das "White Album" der Beatles vorgenommen, doch Produzent Ryan Adams verschleppte das Projekt, bis es im Sand verlief.
Dafür hat sie den ersten Teil ihrer Memoiren geschrieben ("Horror Stories", 2018) und freut sich, dass sie noch in vollen Hallen spielt. Zumindest in den USA, wo für Sommer 2021 eine gemeinsame Tour mit zwei weiteren Größen aus den 1990er Jahren geplant ist, die sich auf ihre Weise auch für Gleichberechtigung eingesetzt haben: Alanis Morissette und Shirley Manson mit ihren Garbage. Im Oktober ist auch ein Auftritt in Hamburg geplant.

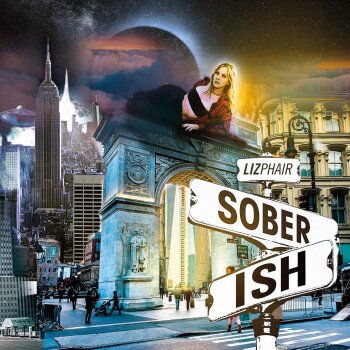

Noch keine Kommentare